Der Konstantinsbogen
Der Ehrenbogen für Kaiser Konstantin, welchen der Senat für den Herrscher errichten ließ,
wurde an prominenter Stelle in der Senke zwischen Caelius und Palatin, direkt an der Via
Triumphalis - jener Straße, über welche alle Triumphzüge römischer Imperatoren führten -
gebaut.
Die lange Inschrift auf beiden Seiten der Attika nennt den Grund der Ehrung: "Imp(eratori)
Caes(ari) Fl(avio) Contantino Maximo / P(io) F(elici) Augusto s(enatus) p(opulus) q(ue)
R(omanus) / quod instinctu divinitatis mentis / magnitudine cum exercitu suo / tam de
tyranno quam de omni eius / factione uno tempore iustis / rem publicam ultus est armis /
arcum triumphis insignem dicavit." - "Dem Kaiser Cäsar Flavius Constantinus Maximus Pius
Felix Augustus weihen der Senat und das römische Volk diesen Triumphbogen, zum Dank dafür,
dass er durch göttliche Eingebung und die Größe seines Geistes zusammen mit seinem Heer
mit gerechten Waffen den Staat an dem Tyrannen und seinen Anhängern rächte."
Es wird erinnert an den Sieg Konstantins im Jahr 312 über seinen Widersacher Maxentius an
der Milvischen Brücke, der der Überlieferung nach nur gelingen konnte, weil Konstantin in
der Nacht vor der Schlacht das Kreuzsymbol erschien, unter welchem die Soldaten dann in
den Kampf zogen.
312 wurde mit dem Bau des Bogens begonnen und drei Jahre später, 315, zum zehnjährigen
Regierungsjubiläum des Kaisers wurde er feierlich geweiht.
Er zählt wegen seines guten Erhaltungszustandes und des außerordentlich reichen
Bildprogramms zu den sehenswertesten Repräsentanten antiker Baukunst.
Freilich ist heute bekannt, dass große Teile der Skulpturen und viele architektonische
Elemente anderen, älteren Bauten entnommen sind und aus der Zeit Trajans, Hadrians und
Marc Aurels stammen. Diese Verwendung von Spolien ist auf den Rückgang der Bedeutung
Roms zurückzuführen. Viele Künstler verließen die Stadt Richtung Konstantinopel,
welches als neue Hauptstadt des Reiches mehr Arbeitsmöglichkeiten für Bildhauer bot.
Die wenigen verbliebenen römischen Ateliers besaßen nicht mehr das nötige Know how zur
kompletten Ausgestaltung dieses großen Denkmals - und so griff man auf Vorhandenes zurück.
Doch nun zum Bogen selbst: er ist in einem dreitorigen Schema mit vorgesetzter
Säulengliederung angelegt, wobei das Mitteltor das dominierende Element darstellt.
Insgesamt ist der Bogen etwa 25 m hoch, 26,7 m breit und 7,4 m tief. Bekrönt wurde
er einst von einer vergoldeten Bronzestatue Konstantins im Triumphwagen.
Die meisten Architekturteile bestehen aus weißem Marmor; durch die Spolienverwendung
jedoch entsteht ein polychromer Farbeindruck, da die wiederbenutzten Stücke aus
unterschiedlichem Material gefertigt waren.
Trotz der "Zusammenstückelung" lag der Gestaltung des Monumentes wahrscheinlich ein
genauer Plan zugrunde, der den Kaiser in den Mittelpunkt der römischen Geschichte
rücken und ihn von weiteren historischen Personen und Ereignissen umgeben lassen
sollte. Um ein harmonisches Ganzes entstehen zu lassen, wurden die älteren Stücke
teils in die passende Form geschnitten und teils inhaltlich umgearbeitet.
Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das reichhaltige Bildprogramm. Einige
Gestaltungselemente der Nord- und Südseite (=Schaufassaden) stammen aus konstantinischer
Zeit und sind deckungsgleich (siehe auch Abbildung 1 und 2). So finden sich auf den
Sockeln jeweils Siegesgöttinnen mit Trophäen und gefangenen Barbaren und in den Zwickeln
der Bögen ebenfalls Siegesgöttinnen sowie Personifizierungen der Jahreszeiten und
Flussgottheiten. Konstantinisch ist ebenfalls der kleine fortlaufende Fries - er ist
etwa 1 m hoch -, welcher sich oberhalb der Seitenbögen um das ganze Monument zieht.
Hier werden Szenen der Taten des Kaisers dargestellt: so beispielsweise die Belagerung
Veronas, die Schlacht an der Milvischen Brücke oder der Triumphzug Konstantins durch Rom.
Formal fällt die hierarchisch-frontale Figurenanordnung auf, die die spätere
Entstehungszeit beweist und als Vorstufe zu mittelalterlicher Kunst gelten kann.
Über diesem Fries befinden sich an beiden Schauseiten je vier Tondi - im Durchmesser 2 m
breit - aus hadrianischer Zeit, welche eine inhaltliche Einheit bilden. Ursprünglich
befanden sie sich an einem Tempel, der dem Ziehsohn Hadrians, Antinous, geweiht war und
sie zeigen den Kaiser mit seinem Gefolge bei Opfer- und Jagdszenen. Dabei wurde das
Gesicht Hadrians so umgearbeitet, dass die Züge Konstantins erkennbar wurden.
Ergänzt werden diese Tondi durch zwei weitere Rundbilder an den Schmalseiten des Bogens,
welche aber aus konstantinischer Zeit stammen und den Sonnengott Sol und die Mondgöttin
Luna zeigen.
Darüber befindet sich das Attikageschoss. Zentral wird auf beiden Schauseiten die
Inschrift über dem Mittelbogen präsentiert. Auf den Plinthen oberhalb der Säulen
befinden sich auf jeder Seite vier Dakerstatuen, die ehemals die Basilica Ulpia
auf dem Trajansforum zierten. Komplettiert wird diese Ebene des Bogens von insgesamt
acht Relieftafeln aus der Zeit Marc Aurels und sie schildern die Ereignisse aus dem
Krieg gegen die Germanen. Sie befanden sich einst auf dem Ehrenbogen Arcus Pani Aurei
am Kapitolsabhang, welchen Commodus für seinen Vater Marc Aurel errichten ließ.
An den Schmalseiten befinden sich im Attikageschoss zwei weitere Relieftafeln, jedoch
aus trajanischer Zeit. Sie bilden mit den zwei Reliefs im mittleren Durchgang eine
Einheit. Filippo Coarelli vermutet, dass sie von der Attika der Basilica Ulpia stammen.
Dargestellt sind Schlachtenszenen. Im Museo della Civiltà Romana befinden sich Abgüsse
dieser vier Reliefs - sie wurden wieder zusammengefügt und sind auf diese Weise als
Einheit zu bewundern.
Wie erging es nun diesem Monument kaiserlicher Repräsentationskunst in Laufe der
Jahrhunderte? Im Mittelalter wurde er zunächst Teil des nahegelegenen Klosters S.
Gregorio Magno, später wurde er zusammen mit dem Kolosseum in die Festung der
Frangipani integriert. Papst Paul III. ließ 1536 den Bogen anlässlich des Besuches
von Kaiser Karl V. wieder freilegen. Seit dem 18.Jahrhundert wurde er untersucht
und 1804 in den Originalzustand zurückversetzt. Heute gilt er als der besterhaltenste
antike Triumphbogen der Ewigen Stadt.
Literatur:
Coarelli, Filippo, Rom. Ein archäologischer Führer, Freiburg 1975.
Pescarin, Sofia, Archäologischer Reiseführer Rom. Antike Bauwerke der Ewigen Stadt,
Köln 2004.
Brinke, Margit/ Kränzle, Peter, Rom. Ein archäologischer Führer, Stuttgart 2002.
Hintzen-Bohlen, Brigitte, Rom. Kunst und Architektur, Königswinter 2005.
 Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
 Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.
Quelle privat 2006.
Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.
Quelle privat 2006.
 Abb. 3 Schemata der Abbildungen.
aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.
Abb. 3 Schemata der Abbildungen.
aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.
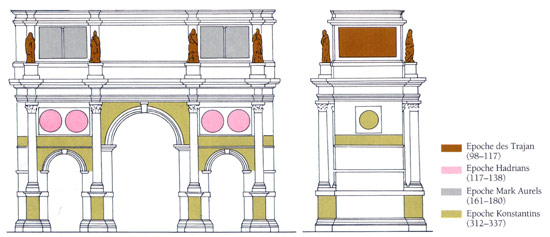 Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.
aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.
back
Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.
aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.
back
 Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
 Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
Abb. 1 Gesamtansicht.
Quelle privat 2006.
 Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.
Quelle privat 2006.
Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.
Quelle privat 2006.
 Abb. 3 Schemata der Abbildungen.
aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.
Abb. 3 Schemata der Abbildungen.
aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.
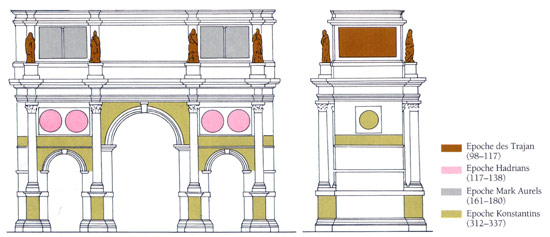 Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.
aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.
Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.
aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.